Von den Hanseaten in der Altmark
Jürgen Haase |
Lassen Sie uns gemeinsam
eine Reise wagen in das weite, flache Land der Antiqua Marchia (Altmark),
wie bereits Karl der Große den Landstrich an der Grenze zum
Karolingerreich nannte. Fahren Sie mit uns als Kaufmann oder Fuhrmann
über das Land, auf dem so mancher Hinterhalt an den alten Handelsstraßen
lauerte und nur starke Schutz- und Trutzbündnisse dem Treiben
der Räuber Einhalt gebieten konnte. Erleben Sie mit uns Burgen,
Schlösser und Stadttore, Kaufmannshäuser – eines prächtiger
als das andere – und Kirchen, die noch heute ihresgleichen suchen.
Ich will hier berichten von den mitteldeutschen Tuchmachern, Leinenwebern,
Bergleuten und Bauern, die ihre Waren zu den Stapelplätzen an
der Elbe brachten oder weiter nach Bremen, Hamburg oder Lübeck,
dem unstrittigen Sitz der Alten und auch der Neuen Hanse, fuhren.
Wir wollen die „Magischen Sieben“ der Altmark besuchen,
die damals mit dem brandenburgischen Havelberg bereits im 13. und
14. Jahrhundert eines der engsten Schutzbündnisse zwischen der
aufstrebenden Bürgerschaft in den rasch wachsenden Städten
gegen Raubrittertum und Fürsten schmiedeten. Begleiten und entdecken
Sie mit uns die wuchtigen Stadttore der sieben altmärkischen
Städte Stendal, Salzwedel, Seehausen/Altmark, Gardelegen, Osterburg,
Tangermünde und Werben sowie das heute zu Sachsen-Anhalt gehörende
Havelberg, welches in vorhanseatischen Zeiten aufgrund der Rückeroberung
durch die Karolinger besonders zu leiden hatte.
Auf der alten Handelsstraße von Magdeburg – ebenfalls
Mitglied der Hanse – nach Stendal erreichen wir das Elbestädtchen
Tangermünde, die erste der altmärkischen
Sieben. Bereits 1368 wird die Stadt an der Elbe als Hansestadt erwähnt.
Kaiser Karl der IV. ernannte Tangermünde 1373 zu seiner Zweitresidenz.
Er fuhr 1375 höchstselbst mit dem Schiff nach Lübeck und
verhandelte mit der Hanse, um Tangermünde als Stapelplatz zu
sichern. Da Städte mit Stapelrechten zu jener Zeit zu den reichen
Ansiedlungen gehörten, kam es um diese Rechte immer wieder zu
Streitigkeiten gar zu Kriegen. Tangermünde war besonders durch
seinen Tuch- und Holzhandel, aber auch durch seine Getreisenden delieferungen
bekannt. Die Bedeutung der Zollstätte sank in der Folgezeit.
Rathaus, Kaiserburg, Stephanskirche oder die Stadttore sind heute
Zeugen einer einst bedeutenden Handelsstadt.
Wenden wir uns nun auf der alten Handelsstraße Stendal –
Braunschweig nach Nordwesten, so treffen wir auf die mächtigste
der altmärkischen Hansestädte.
Die Perle der Altmark, Stendal hatte als reichste
und schon damals schönste Hansestadt in der Altmark als eine
der ersten hanseatischen Binnenstädte Verbindungen zu den Seestädten
der Hanse geknüpft. Vor allem den Tuchmachern und Gewandschneidern
war es zu verdanken, dass der Marktflecken, 1160 von Albrecht dem
Bären mit Zoll- und Münzrecht versehene Ansiedlung innerhalb
kurzer Zeit zur reichsten Stadt der Mark Brandeburg und der damals
drittgrößten Stadt Deutschlands aufstieg. Bereits 1022
erstmals urkundlich als Steinedal erwähnt, entwickelte sich die
Stadt an der Kreuzung zweier großer Handelsstraßen zum
zentralen Umschlagplatz zwischen Seehandel und Binnenland. Heute erleben
wir das kulturelle Zentrum der Altmark mit hanseatischen Schätzen
wie einer Astronomischen Uhr, über 500 Jahre alten Glocken, und
dem Dom St. Nicolaus als eine Stadt, die sich stolz zu ihren hanseatischen
Traditionen bekennt und diese auch nach Kräften wahrt. Bereits
1188 wird ein erstes Kaufhaus erwähnt, der überseeische
Handel wurde mit stadteigenen Schiffen abgewickelt, in der Marienkirche
das größte Geläut der Altmark installiert und auch
der drittgrößte freistehende Roland in Deutschland, zeugen
von der Macht der reichen Patrizier zur Hansezeit. Bereits 1338 wurde
die erste Bürgerschule in der Stadt ge- |
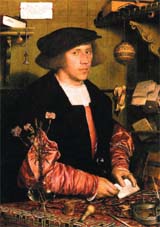
Ein Danziger Hansekaufmann (Holbein d. Ä.) Foto: wikipedia

Das Holstentor von Lübeck (Kulturstiftung der Hansestadt
Lübeck)

Die Hansekogge „Adler von Lübeck“
(Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck)

Siegel der Stadt Salzwedel aus
dem 13. Jahrhundert
|
 |
 |
gründet. Stendal, „die Vieltürmige“
hat neben zahlreichen Kirchen aus der Hansezeit, wie St. Marien, auch
mächtige Stadttore zu bieten. Das Uenglinger Tor, ein Bauwerk
dem nur das Holstentor in Lübeck Gleichwertiges an Pracht und
Baukunst entgegen zu setzen hat, viele Kaufmannshäuser und museale
Stücke zeugen von der einträglichen Verbindung zwischen
den Hansestädten der alten Welt und dem Willen der Bürger,
diese Traditionen weiter zu pflegen.
Von Stendal ging es zu Hansezeiten mit einer bewaffneten Eskorte über
den gut ausgebauten Handelsweg weiter nach Gardelegen.
Die Hansestädte der Alten Mark hatten untereinander präzise
Verträge über das Geleit ihrer Kaufleute
ausgehandelt. So hatten bald auch die Raubritter, die sogar aus dem
Harz kamen, keine Chance mehr, leichte Beute zu machen. Stadtmauer
und Pulverturm von Gardelegen grüßen schon von weitem und
fährt der Betuchte in Richtung Salzwedel, kann er dass wohl wuchtigste
aller Torbauwerke
der Altmark, das Salzwedler Tor bewundern. Vom Reichtum der Gardeleger
künden auch Rathaus, Fachwerkbauten wie das Förster` sche
Haus oder der Turm der Nicolaikirche. Seit 1358 ist die Bierbrauerstadt
Gardelegen Hansemitglied. Bekannt schon weit vorher als Mitglied im
altmärkischen Städtebund und an der alten Handelsstraße
Braunschweig/Stendal gelegen, spielte die Stadt an der Milde zunächst
eine wichtige Rolle als Hopfen- und später als Bierlieferant.
Eine Rolle, die sie bis heute mit ihrem berühmten „Garley“
nicht verloren hat, nicht nur zur Freude der „Neuen Hanseaten“.
Weiter fahren wir nach Norden auf dem alten Handelsweg Hamburg/Uelzen/Lüneburg
und sehen bald die Stadtmauern von Salzwedel. Nun
schon mit Tangermünder Getreide, Stendaler Tuchen und köstlichem
Garley beladen, können wir uns in der Stadt an der Jeetze - oder
auch das Venedig der Altmark -, entscheiden, ob wir unsere Waren im
Jeetzehafen auf ein Schiff nach Hamburg verladen oder den beschwerlichen
Landweg weiter folgen. Für den Handel war auch die Flussschifffahrt
auf der Jeetze wichtig. Der von den
Lüneburgischen Herzögen für die Schifffahrt freigehaltene
Fluss mit dem Hafen Salzwedel und dem dortigen Hansehof hatte noch
bis 1909 als Schifffahrtsweg nach Hamburg seine Berechtigung. So wird
für die Civitas Soltewidele (Stadt Salzwedel) in einer Urkunde
vom 28. Mai 1233 bescheinigt,
dass der Tuchhandel einen wichtigen Handelszweig darstellt und in
einer weiteren Schrift 1263 die Stadt als Mitglied der
gotländischen Gesellschaft, einem Gründungsvorläufer
der
Hanse, in Wisby registriert wurde. In Letzterer teilt der Rat der
Stadt Lübeck ihrem Ältermann auf Gotland mit, dass er die
Bürger von |

Die Schnitzwand aus dem Jahre 1462
im Stendaler Rathaus
(Foto: AWA/Frank Mühlenberg)

Lübecker Stadtsiegel
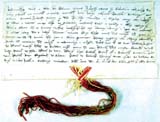
Urkunde vom 17. Juni 1263, in der Salzwedel in die gotländischen
Gesellschaft aufgenommen wird.
|
| Salzwedel in die Genossenschaft der gotländischen
Stadt aufgenommen hat, womit der 17. Juni 1263 als Beitrittsdatum
der Altmarkstadt zur Hanse gilt. Wesentlich für die frühe
Anerkennung Salzwedels war das Wirken Alexanders von Salzwedel,
der für die Stadt Lübeck als Feldherr und Ratsherr
lange Jahre erfolgreich tätig war und als Fürsprecher
der Aufnahme seiner Heimatstadt in das Schutz- und Kaufmannsbündnis
galt. Bis 1488 entwickelte sich die Hansestadt auf Grund des
florierenden Handels mit nordischen Staaten und ihrer engen
Verbindungen nach Lübeck, Bremen und Hamburg rasant. In
Salzwedel liefen die alten Handelswege zusammen. Zahlreiche
Fleeten durchschneiden das Stadtgebiet, Altes Rathaus, St. Marien,
St. Lorenz und St. Katharinenkirche schicken ihre Türme
gen Himmel und das Steintor zeugt noch heute von der Wehrhaftigkeit
des einstigen Salzumschlag- und Stapelplatzes Salzwedel. |
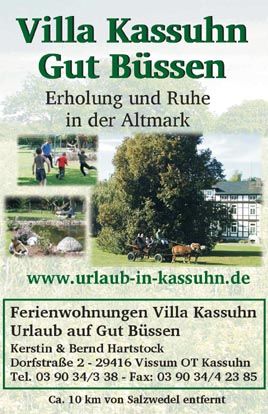 |
|
|

