vor 300
Jahren – 24.01.1712
Zum 300. Geburtstag des preußischen Königs, der
Europa veränderte:
Friedrich der Große
|
Friedrich
der Große war eine jener großen Persönlichkeiten,
die ein jeder sich in seine Zeit wünscht. Aber natürlich
war er vor allem ein Mensch, der wie alle Menschen kontrovers und
mehrschichtig war, den man nicht auf nur ein oder zwei Eigenschaften
fest machen konnte, sondern der sich auch mal mit seinen Handlungen
widersprach, der auch mal Fehler machte - wie wohl jeder von uns.
Und er lebte in einer Zeit, in der Kriege eine akzeptable Form der
Politik waren.
Prinz Friedrich wurde am 24. Januar 1712 geboren. Bereits ein Jahr
später verstarb sein Großvater. Sein Vater, der Soldatenkönig
Friedrich Wilhelm I. folgte auf dem preußischen Thron. Für
Preußen bedeutete das Abschied von Müßiggang und
Verschwendung, für den kleinen Fritz absolutes Reglement von
früher Stunde bis in den Abend. Der Soldatenkönig kann wohl
als Begründer preußischer Tugenden benannt werden. Er verzichtete
auf allen Pomp, achtete auf Ordnung und Haushaltung, sah sich stets
in allen Dingen in der Pflicht und was er sich selbst abverlangte,
das forderte er auch von seinen Untertanen. Und ein Unteran war eben
auch sein Sohn Friedrich. Die Konflikte waren vorprogrammiert. Als
Friedrich 1728 heimlich Flötenunterricht nahm, untersagte es
ihm sein Vater, da es weder fürs Staatswesen noch fürs Militärische
von Nutzen sei. Daraufhin plante Friedrich zwei Jahre später
mit seinem Freund Katte aus dem Jerichower Land seine Flucht nach
Frankreich. Die beiden wurden gefasst. Friedrich kam in strengen Hausarrest,
Katte wurde wegen Desertion zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch
der König hielt das nicht für gerecht, denn jedem einfachen
Soldat drohte beim Desertieren die Todesstrafe. Er machte eine Notiz
auf dem Urteil „Sie sollen Recht sprechen und nicht mit dem Flederwisch
darüber gehen“ und verlangte den Tod für Friedrich
und für Katte. Viele Herrscherhäuser, sogar der Kaiser,
schrieben nun dem preußischen König und baten um Milderung
des Urteils für den Kronprinzen. Wohl eher widerstrebend entsprach
der Soldatenkönig den Bittgesuchen. Doch ganz einfach davon kommen
lassen wollte er den jungen Prinzen nicht. Vor den Augen des jungen
Friedrich wurde Katte in Küstrin mit einem Schwert geköpft.
Was das bei einem jungen Menschen für Auswirkungen hat, können
wohl nur wenige wirklich sagen. Friedrich war dem Selbstmord nah,
denn er wollte lieber gleich dem Katte tot sein, als nun mit diesem
Schmerz leben zu müssen. Erst 1732 bekam er vom Vater sein Regiment
und die Privilegien eines Prinzen zurück.
Nach der missglückten Absprache, den Kronprinzen mit der Tochter
des Kaisers, Maria Theresia, zu verheiraten, wird Elisabeth Christine
von Braunschweig-Bevern ausgewählt. Das Paar wohnt nach einem
Ruppiner Aufenthalt alsbald in dem vom Vater gekauften Schloss Rheinsberg,
welches er 1736 Friedrich schenkt. Es beginnen die für Friedrich
glücklichsten Jahre seines Lebens, so zumindest äußerte
er es mehrfach. Er wendet sich mehr und mehr der Kunst, der Philosophie,
der Geschichte und der Musik zu. Fast unbeschwert kann er hier meilenweit
entfernt vom Vater seinen eigenen Ambitionen frönen. Er lädt
bedeutende Künstler und Denker seiner Zeit zu sich ein und kann
mit diesen nächtelang philosophieren. 1738 komponiert Friedrich
seine erste Sinfonie. Kurz darauf veröffentlicht er den „Antimachiavell“,
einen Tugendkatalog der Aufklärung.
Der Tod seines Vaters am 31. Mai 1740 beendet diese schöne Zeit
sehr plötzlich. Friedrich wird als Friedrich II. zum König
in Preußen. Nun könnte man meinen, er würde seinem
Vater einiges übel nehmen, ihn hassen, alles umkrempeln - aber
weit gefehlt, Friedrich verehrte seinen Vater sehr und ließ
am Hof nicht zu, dass man sich negativ über seinen Ahnherrn äußerte.
Als sich Baron von Pöllnitz an der Tafel einmal wagte, über
den Vater zu lästern, sprang er auf und meinte: „Monsieur,
ich will das Andenken meines Vaters in Ehren gehalten haben, und wo
Er sich dergleichen noch einmal untersteht, so werden wir uns ewig
brouillieren.“ Und die Gegenwärtigkeit seines Vaters war
wohl auch einer der Gründe, die ihn nun in den Krieg führte.
|

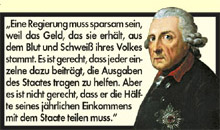

Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern
als Königin von Preußen
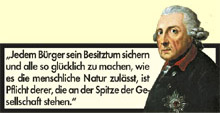
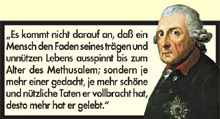
|
Aber
es gab weitere Gründe. Am 20. Oktober 1740 verstarb der Kaiser
in Österreich. Sehr oft wurden genau dann Kriege geführt,
wenn ein Reich vorerst führerlos war, es um die Erbfolge ging.
Für Friedrich war dies also ein günstiger Zeitpunkt. Der
gewichtigste Grund aber war das Recht auf Schlesien, welches seit
dem Aussterben der Piasten 1537 Brandenburg versprochen war. Keiner
der nachfolgenden Kaiser hatte aber diesem Recht entsprochen, weil
die Habsburger eben in Österreich regierten und Schlesien nun
zum Interessengebiet Österreichs gehörte. So wurde dieses
Recht auf Schlesien vom böhmischen König bestritten und
aufgehoben, von den folgenden Kaisern nicht anerkannt. Doch die Urkunde
über die Liegnitzer Erbverbrüde-rung lag vor und nach Friedrich
war sie bindend. So setzte Friedrich II. nun um, was man dem Großen
Kurfürsten einst versprochen und keiner der brandenburgisch-preußischen
Nachfolger mehr umgesetzt bekam.
Am 8. November 1740 erfolgte in Preußen die Mobilmachung. Der
„Alte Dessauer“ (Fürst Leopold von Anhalt-Dessau) als
preußischer Feldmarschall warnte Friedrich vor diesem Unternehmen
und bat in die Planung direkt einbezogen zu werden. Friedrich aber
war gegen jeden misstrauisch. So schrieb er dem weisen Feldmarschall
am 2. Dezember 1740: „...allein diese Expedition (Schlesischer
Krieg) reser-vire ich mir alleine, auf dass die Welt nicht glaube,
der König in Preussen marschiere mit einem Hofmeister zu Felde.“
Das war natürlich für den alten Haudegen aus Dessau ein
Affront, hatte er doch in vielen Schlachten sein Talent bewiesen,
sein Leben riskiert. Dennoch focht der Fürst für Friedrich
und siegte in einigen wichtigen Schlachten. Friedrich mäßigte
auch bald den Ton gegenüber seinem Vetter.
|
Und
der Erste Schlesische Krieg wurde zu einem gewaltigen Erfolg. Bis
zum Januar 1741sind die Österreicher aus Schlesien vertrieben.
Nur die Festungen Glogau, Brieg und Neiße verblieben in ihrer
Hand. Noch im Februar stürmt der Alte Dessauer die Festung Glogau.
In den wenigen Schlachten siegen die Preußen. Und nachdem Hannover/Großbritannien,
Frankreich, Sachsen und Russland sich nicht gegen Preußen wenden,
ist der Krieg gewonnen. Doch Friedrich beweist in diesen ersten Thronjahren
sein Geschick, seine Weit- und Vorsicht. Die wichtigen Kuriere werden
in einer Geheimschrift verfasst, die für den Gegner - falls der
Kurier abgefangen wird - unleserlich bleibt. In allen wichtigen Städten
so in Hannover, Dresden, Kassel, Petersburg, befinden sich verkleidete
Offiziere, um Truppenansammlungen oder politische Wendungen auszukundschaften.
Seine Truppen hält er so, dass er auf sämtliche Eventualitäten
reagieren kann. Während die Hauptarmee mit ihm an der Spitze
in Schlesien agiert, befinden sich Regimenter zum Abfangen eines Angriffs
aus Richtung Frankreich, Russland oder Hannover in Grenznähe.
Der nun folgende Zweite Schlesische Krieg war wiederum seinem allzu
großen Misstrauen und der großen Vorsicht geschuldet,
denn eigentlich war der Kaiserthron bereits an den bayrischen Kandidaten
gegangen, seine Errungenschaften in Schlesien noch keineswegs bedroht.
Dennoch, Österreich war 1742 in Bayern eingefallen, Kaiserin
Maria Theresia nun in der Lage, die schlesischen Besitzungen zurück
zu gewinnen. Friedrich reagierte, versicherte sich seiner Bündnispartner
Frankreich, Bayern, Sachsen und marschierte in Böhmen ein, nahm
am 16. September 1744 Prag und zog sich dann wieder nach Schlesien
zurück.
|
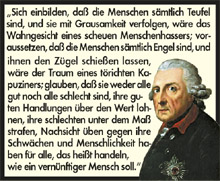
|
Am
9. Oktober 1744 erzwang der berühmte alte Husarengeneral Zieten
den Übergang über die Moldau. Dabei fiel der Leutnant von
Wedell, ein Liebling des Königs. Als dieser die Meldung davon
erhielt, ritt er mit dem Rufe: „Wo ist Wedell? Wo ist Wedell?“
durch die Reihen der Verwundeten. Da richtete sich ein Leutnant auf,
dem der Fuß zerschossen war, und antwortete: „Majestät,
hier liegen lauter Wedells.“ – „Er hat mir eine gute
Lehre gegeben,“ entgegnete ihm der König.
Nun aber brach Sachsen aus der Allianz aus und verbündete sich
mit Österreich, Hannover/Großbritannien und der Niederlande
gegen Preußen. Schon marschierten die Österreicher in Schlesien
ein. Es folgt die gewaltige Schlacht bei Hohenfriedberg, in der Friedrich
siegt. Und indessen er sich hier mit den Österreichern schlägt,
hält er wie auch im ersten Krieg eine zweite Streitmacht unter
dem Alten Dessauer bereit, um folgend in das wortbrüchige Sachsen
einzufallen. Auch Fürst Leopold siegt am 12. Dezember 1745 in
der Schlacht bei Kesselsdorf gegen die alliierten Sachsen und Österreicher.
Dennoch war es ein fürchterliches Massaker. Der preußische
Angriff wurde zweimal unter furchtbaren Verlusten zurückgeschlagen.
Die Preußen mussten sich daraufhin zurückziehen, verfolgt
von den Alliierten, die den Preußen nun den Rest geben wollten.
Jetzt reagiert der kampferprobte Dessauer und ließ seine Kavallerie
in die feindliche Reihen stürmen, bis diese völlig aufgerieben
waren und er die Artilerie nehmen konnte. Dieser Sieg war der letzte
des Fürsten aus Dessau, aber er war der entscheidende für
den Gewinn des Krieges.
|
Da
der Krieg nun beendet, widmete sich Friedrich der Große den
Staatsgeschäften - und da gab es seiner Meinung nach viel zu
tun. So schaffte er die Folter ab und forderte Strafen, die der Tat
verhältnismäßig angepasst wären. Er kümmerte
sich in besonderem Sinne um die Strukturen des Staates, vor allem
um die Staatsdiener: „Wenn die Beamten fleißig arbeiten,
so können sie ihre Arbeit des Morgens in laufenden Sachen innerhalb
drei Stunden verrichten. Wenn sie sich aber Geschichten erzählen
und Zeitungen lesen, so ist der ganze Tag nicht lang genug.“
Auch stammt vom alten Friedrich der Satz, dass ein höherer Beamter
die gleiche Arbeit zu leisten hätte wie sein untergebener Sekretär,
und nicht nur zum Anschauen da sei. Wie klug er doch war und welche
Wirkung dieser Satz noch heute hat.
Elf Jahre bleiben ihm Zeit, dem Staat sein Gepräge aufzudrücken,
dann änderte sich im Herzen Europas das Gleichgewicht der Mächte.
Österreich gelang es, mit Sachsen, Russland und später auch
Frankreich ein Bündnis zu schließen. Friedrich der Große
bekam Abschriften in die Hand und wartete auch diesmal nicht, dass
die Feinde ihn angriffen. Nach der Devise „Angriff ist die beste
Verteidigung“ zog er am 29. August 1756 zum dritten Mal gegen
Österreich aus, in einen Krieg, der ganze sieben Jahre dauern
sollte. Und dieser Siebenjährige Krieg wurde ein anderer. In
Ostpreußen marschierten die Russen ein. Die Österreicher
waren aus Schlesien nicht herauszuschaffen. Am 16.10.1756 kapitulieren
zwar die Sachsen nach Kämpfen bei Pirna und Lowositz, aber am
17. Januar 1757 wird der Reichskrieg gegen Preußen ausgerufen.
|
 |
Die Schlacht von Kolin am 18. Juni 1757 wandelte sich zu einer preußischen
Niederlage, obwohl sich die Österreicher schon auf dem Rückzug
befanden. Der sächsische Reiteroberst Beukendorff ritt auf eigene
Faust eine Kavallerieattacke, der die erschöpften preußischen
Bataillone nichts mehr entgegen zu setzen hatten. In Verzweiflung
sammelte Friedrich etliche Männer um sich: „Kerls, wollt
ihr das ewige Leben haben?“ Ein alter bärtiger verwundeter
Grenadier antwortete: „Fritze, ich dächte, um dreizehn Pfennig
Löhnung wäre es für heute genug!“ Friedrich ließ
den Mann verschnaufen, nahm den Rest und befahl, die Trommeln zu schlagen.
Er führte die Männer gegen eine feindliche Batterie. Einer
nach dem anderen fiel. „Sire,“ rief sein Adjutant, „wollen
Sie die Batterie allein erobern?“ Nun dringen die Österreicher
in Berlin ein. Friedrich gibt nicht auf, er zieht gegen die Franzosen
samt der Reichsarmee und siegt in der Schlacht bei Roßbach (5.11.1757)
durch seinen hervorragenden Reitergeneral von Seydlitz. Von Roßbach
(Sachsen-Anhalt) zieht er in einem mörderischen Marsch nach Leuthen
(heute Lutynia in Niederschlesien/Polen) und schlägt die österreichische
Armee in der außergewöhnlichen Schlacht bei Leuthen (5.12.1757).
Fürst Moritz von Anhalt-Dessau wird noch am Abend zum Feldmarschall
ernannt. Im August 1758 hatte sich Friedrich bei Zorndorf noch erfolgreich
gegen die Russen wehren können, um ihnen den Weg nach Berlin
zu versperren und eine Vereinigung mit dem österreichischen Heer
zu versalzen. Im Oktober 1758 aber wurde sein Lager bei Hochkirch
in Schlesien von den Österreichern überrannt. Dann verlor
er die so wichtige Schlacht bei Kunersdorf (unweit Frankfurt/Oder)
am 12. August 1759. Friedrich den Großen überfiel eine
„große Krisis“.
|

Die Schlacht bei Leuthen
|
Eigentlich
war dieser Krieg für Preußen verloren. Die Franzosen im
Westen, die Österreicher im Süden, Die Schweden im Norden
und die Russen im Osten. Stets hatte sich Friedrich selbst mit in
den Kampf geworfen, war von Norden nach Süden, von Süden
nach Norden marschiert, um die feindlichen Heere zu „deffendieren“.
Und doch hatte alles nichts genützt. Ostpreußen, Sachsen,
Schlesien und Teile Pommerns waren in der Hand des Gegners, dessen
Gesamtkräfte um ein Vielfaches höher waren, als die beim
Alten Fritz verbliebenen Preußen. Ein wenig Entlastung verschaffte
die glorreiche Schlacht bei Torgau am 3. November 1760. Die Verluste
waren auf beiden Seiten erheblich hoch. Die Preußen hatten an
die 52.000 Mann in die Schlacht geschickt, davon waren über 15.000
Mann Verluste.
Erst der Tod der russischen Zarin Viktoria rettete Preußen.
Denn der neue Zar Peter, war ein Bewunderer des alten Friedrich. Er
machte 1762 Frieden mit Preußen. Schweden zog sich zurück
und Österreich war kaum imstande, den Krieg allein weiter zu
führen. 1763 kam es zum Friedensschluss von Hubertusburg.
1947 erklärten die Alliierten Preußen für aufgelöst,
Ost- und Westpreußen, Schlesien fielen an Russland und Polen.
Aber was wäre aus Deutschland geworden ohne Friedrich den Großen?
Gäbe es uns in dieser Form überhaupt noch? Wäre unser
Land damals aufgeteilt worden zwischen Russland, Österreich und
Frankreich, wie es mit Polen 1772 geschah... Darauf kann aber keiner
eine Antwort geben.
Mit der Aufteilung Polens und der Anbindung des preußischen
Königreiches an die Mark Brandenburg durfte sich Friedrich künftig
König von Preußen nennen. Er starb am 17. August 1786 im
Schloss Sanssouci mit den Worten: „Wir sind über den Berg,
jetzt wird's besser gehen!“
Axel Kühling
|

Die schlesischen Stände huldigen 1741 dem preußischen
König Friedrich II.
|
| |
|

